
Mit der Installation des medSPACE und der dort unterrichteten virtuellen Anatomie nimmt die Medizinische Fakultät der Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz eine Vorreiterrolle ein. Wie sich der Einsatz neuer Technologien in der Lehre auswirkt, welche Skills die Mediziner*innen von morgen entwickeln müssen und wie gut die Vernetzung zwischen Forschung und Klinik funktioniert, diskutierten Lehrende und Studierende. Klinikguide.at sprach mit Univ.-Prof. Dr. Maren Engelhardt, Leiterin des Instituts für Anatomie und Zellbiologie an der JKU, Prim. Univ.-Prof. Dr. Franz Fellner, Vorstand des Zentralen Radiologie Instituts am Kepler Universitätsklinikum und Lehrender an der JKU, sowie Victoria Schopf und Florian Fussi, Medizinstudierende im 4. Semester.
Was sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse bezüglich des Unterrichts in virtueller Anatomie?
Florian Fussi: Die virtuelle Anatomie ist eine Ergänzung und Intensivierung des Basisunterrichts der Anatomie. Man sieht, wie sich die Strukturen zueinander verhalten und bekommt dadurch ein räumlicheres Denken, als wenn man die Zusammenhänge nur im Lehrbuch oder auf den Vorlesungsfolien sieht.
Victoria Schopf: Mir hat das z. B. besonders im Modul über das Nervensystem geholfen, weil man sich die Gehirnstrukturen nicht so gut vorstellen kann wie z. B. einen Muskel des Beins. Die Verbindung mit den radiologischen Themen, mit Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT), war sehr spannend und hat mich dabei unterstützt, alles in einen Kontext zu setzen.
Engelhardt: Es gibt viele Studierende, die Schwierigkeiten haben, sich Dinge dreidimensional vorzustellen. Natürlich haben wir Möglichkeiten, mit Modellen und v. a. auch Plastinaten zu arbeiten. Aber dennoch gibt es genügend Studierende, die sehr davon profitieren, wenn sie sich z. B. die Gefäße im Schädel isoliert vorstellen können. Was aber trotzdem nie sichtbar wird, ist die Komplexität des Ganzen. Die Gefäße sind ja von vielen anderen Strukturen umgeben, weswegen wir im Unterricht auch zunehmend echte Präparate einsetzen. Wir haben also ein Dreigestirn aus der Plastinate-Anatomie, der Dreidimensionalität in der virtuellen Anatomie und echten menschlichen Präparaten. Diese Kombination der verschiedenen Lehrkonzepte und v. a. auch der dreidimensionalen Darstellung im medSPACE empfinde ich als absolutes Zukunftskonzept.
Franz Fellner: Was mir durch den Unterricht in virtueller Anatomie bewusst geworden ist, ist, dass die Anatomie überall anders aussieht – an der Leiche, im OP, in Röntgen-, CT- oder MRT-Bildern. Es handelt sich sozusagen um verschiedene Sprachen, die dasselbe beschreiben. Und diese verschiedenen Sprachen lernen unsere Studenten gleich von Anfang an. Das ist glaube ich das Entscheidende, dass man ein Bewusstsein dafür schafft, dass die Grundstruktur gleich ist, sie aber je nach Situation anders aussieht und man sie lesen lernen muss.
Welche Chancen entstehen aus der interdisziplinären Zusammenarbeit?
Florian Fussi: Ich finde es wichtig, dass man einen Überblick über das große Ganze bekommt und das ist auch im Linzer Curriculum verankert.
Victoria Schopf: Das verschafft uns später bestimmt einen Vorteil, wenn wir im klinischen Leben stehen und vielleicht einmal mit Situationen konfrontiert sind, die sich vom Lehrbuch unterscheiden.
Maren Engelhardt: Linz hat einen Modulstudiengang, das heißt, es wird quasi in Organsystemen unterrichtet und das quer durch alle Fächer. Physiologie und Anatomie stellen die Kernfächer dar und rundherum positioniert sind die Pharmakologie, die Pathologie und diverse andere Disziplinen, die immer zum gleichen Thema zwei oder vier Wochen lang ein ganzheitliches Bild eines Organsystems vermitteln. Ich glaube das spiegelt auch die klinische Notwendigkeit wider, denn uns fehlen v. a. Allgemeinmediziner*innen, die in der Praxis relativ schnell ein Verständnis dafür entwickeln können, wo das Problem ist und an welche Spezialist*innen man die Patient*innen überweisen kann. Wir wollen Mediziner*innen hervorbringen, die entweder selbst zu Spezialist*innen werden oder die Patient*innen als Ganzes sehen, weil sie die verschiedenen Strukturen und die Physiologie auch als Ganzes verstehen. Und so können sie die Patient*innen schlussendlich besser beraten und behandeln.
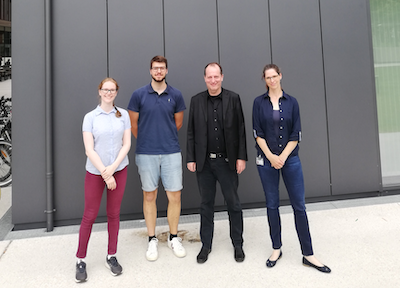
Welche Skills brauchen Mediziner*innen der Zukunft außerdem?
Florian Fussi: Ein grundlegendes technisches Verständnis, z. B. in Bezug auf Computer, und das Wissen, wie man zu den Informationen kommt, die man braucht, sind sehr wichtig.
Victoria Schopf: Ich finde, dass man das aber auch fördern müsste, weil es relativ viele junge Leute gibt, die trotz der Zugehörigkeit zur Technikgeneration nicht so technikaffin sind. Eine gewisse Einführung wäre da gut.
Maren Engelhardt: Ärzt*innen brauchen außerdem die Fähigkeit, mit ihren Händen zu arbeiten, auch wenn sie diese nicht sehen können – eine gewisse Hand-Augen-Koordination ist das Rüstzeug für jede/n Arzt/Ärztin, egal ob er/sie operiert oder nicht. Ich merke das schon im 1. Semester, wenn die Studierenden am Mikroskop sitzen, dass sie größte Schwierigkeiten haben, durch die Okulare zu schauen und gleichzeitig mit den Händen das Bild scharfzustellen, obwohl das wirklich basale Dinge sind. Studierende, die zusätzlich in die Forschung gehen und z. B. Labortiere operieren, brauchen die Hand-Augen-Koordination auch dringend.
Welchen Stellenwert hat der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der Medizin?
Franz Fellner: In den 90er-Jahren gab es erste Screening-Programme für Lungenkarzinome im CT und Brustkrebs in der Mammographie. Aber wir haben damals den Einsatz schnell wieder eingeschränkt, weil es zu vielen falsch positiven Befunden gekommen ist. So wurden z. B. normale Gefäßanschnitte als Läsionen angezeigt. Soweit ich weiß, führt das heute immer noch zu Problemen, aber die KI ist viel besser geworden und kommt in manchen Praxen und Kliniken schon zum Einsatz. Der Trend geht wie bei den Autos in Richtung eines Assistenzsystems, das etwas anzeigt, das der Mensch aber kontrollieren muss.
Maren Engelhardt: Ein Fachgebiet, das KI nutzt und ausbaut, ist die Pathologie. Die KI sieht in den Präparaten aus dem OP durchaus Dinge, die ein menschliches Auge nicht mehr sieht. Aber wir müssen die KI noch intensiv trainieren, damit sie wirklich das Ausmaß an Problemerkennung aufweist, das routinierte Patholog*innen nach vielen Jahren Arbeit haben.
Wie gut funktioniert die Vernetzung zwischen Forschung und Klinik in Österreich?
Franz Fellner: Man kann zwar immer alles verbessern, aber sie ist nicht so schlecht. Ich habe vor einigen Jahren von einer Evaluation der wissenschaftlichen Leistung an den österreichischen Universitäten gehört und da haben die Gutachter*innen gesagt, dass es im Bereich Radiologie in Österreich im Vergleich zum internationalen Standard sehr gut funktioniert.
Maren Engelhardt: In Grundlagenfächern wie Anatomie und Zellbiologie verhält es sich ein bisschen anders. Im österreichischen Bachelor-Master-System ist es schwieriger, die Studierenden ins Labor zu bekommen, weil das Curriculum die dafür nötige Zeit nicht vorsieht. Im deutschen System können Studierende hingegen nach dem ersten Abschnitt für vier bis fünf Jahre im Labor arbeiten, wenn das Interesse besteht. In Linz wurde ein PhD-Programm ins Leben gerufen, damit diejenigen, die sich dafür interessieren, nach ihrem Master-Abschluss den Weg in die Forschung finden können. Allerdings bedeutet das weniger bis gar keine Zeit in der Klinik, bis man den PhD hat. Hier müssen wir noch bessere Konzepte erarbeiten, was von der JKU auch gefördert wird.
Insgesamt finde ich, dass die Zusammenarbeit zwischen vorklinischen und klinischen Fächern sehr gut ist. In den vorklinischen Fächern müssen wir uns aber noch geeignete Konzepte überlegen, wie wir Mediziner*innen in die Grundlagenwissenschaft locken. Denn ohne die Mediziner*innen in der Grundlagenwissenschaften sterben Fächer wie die Anatomie irgendwann aus.
Vielen Dank für das Gespräch!
Medizin der Zukunft, Teil 1: Die Eroberung des medSPACE
Medizin der Zukunft, Teil 3: Technologien der Zukunft im OP-Saal
Wann kommt das Krankenhaus 4.0? Prof Dr. Siegfried Meryn im Interview.
Gesund werden in der Slow Clinic?
Klinikguide.at-Autorin: Mag. Marie-Thérèse Fleischer, BSc
Bildnachweis:
- © MTF
Meistgelesen
So finden Sie den*die richtigen Arzt*Ärztin!
Gesundheit in ganz Österreich finden!
Wie stärke ich mein Immunsystem?
Was können Patientenanwält*innen erreichen?
High-Tech im Operationssaal in Steyr: Roboter assistiert den ChirurgInnen
Vorsicht Winter und Schneeschaufeln: Die unbekannte Gefahr für Herz und Kreislauf
Künstliche Intelligenz im Einsatz für die Medizin
Prostatakrebszentrum Wels – Gebündelte Expertise für individuell beste Therapieoptionen
Neue Art der Behandlung mindert die Chance der Rückkehr von Brustkrebs









